Vorwort |
|
|
|
|
|
|
Grundsätzliches |
|
|
|
|
Komponenten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zylinder & Kopf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gehäuse |
|
|
|
|
DichtflÀche planen |
|
| Die GehĂ€use-DichtflĂ€che eines Smallframe-Motorblocks ist eigentlich ausreichend groĂÂ, um
die GehĂ€use-ĂÂS weit aufzumachen - auch noch, wenn aufgeschweiĂÂt wurde fĂÂŒr ambitionierte
ĂÂberströmer. |
| Dennoch kann es gewollt sein, dass die ĂÂS noch gröĂÂer werden sollen, als es die
DichtflÀche zulÀsst. Dann muss, um den Motor nicht durch Falschluft zu schrotten, die
DichtflÀche erweitert werden. Da gibt es drei Möglichkeiten: |
|
| 1.) die DichtflÀche am GehÀuse um etwa 0,9mm abplanen (lassen). Dies muss eventuell
durch eine FuDi wieder ausgeglichen werden, da sich sonst die Steuerzeiten des Motors verÀndern.
SchlieĂÂlich sitzt der Zylinder nun ja "tiefer" als vorher. |
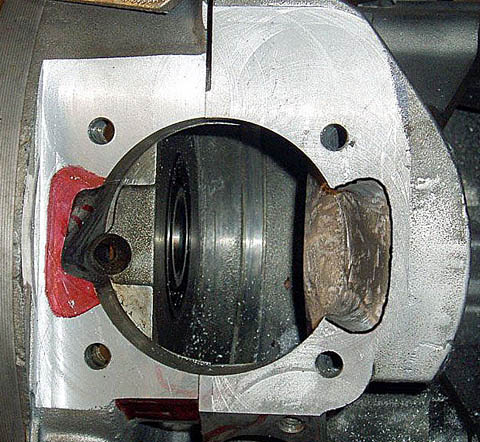 |
| Rechts gut zu erkennen: Das GehÀuse ist
abgeplant, die DichtflĂ€che nun gröĂÂer/breiter. |
|
| 2.) An den problematischen Stellen SchweiĂÂpunkte setzen oder Kaltmetall auftragen und
diese Stelle dann plan feilen. |
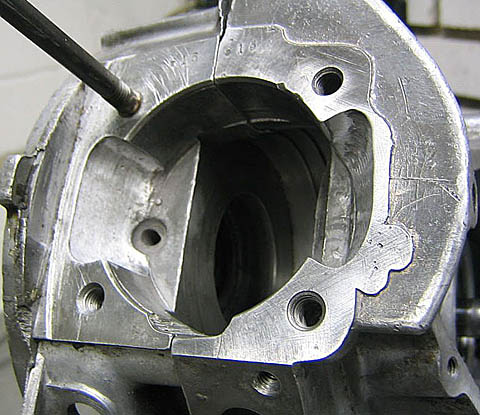 |
| Das GehÀuse von Dennis N. (GSF-Nick:
"smallframejunk"): Rechts unten der SchweiĂÂpunkt. |
|
| 3.) das fehlende StĂÂŒck DichtflĂ€che mittels Dichtmasse (Dirko, Silikon) auftragen. |
|
| FĂÂŒr einen Rennmotor ist Möglichkeit 3 definitiv nicht (!) die
richtige Wahl! |
|
|
|
|
Kupplung |
|
|
|
|
Zündung & Elektrik |
|
|
|